Platon, Epistemologie II
- Stephan Sturm
- 28. Jan. 2025
- 10 Min. Lesezeit

1 Ist Wissen dasselbe wie Wahrnehmung?

Protagoras hatte die These aufgestellt, dass Wissen ausschließlich auf Wahrnehmung beruht und im Grunde mit ihr identisch sei. Dazu hatte er den Homo-mensura-Satz aufgestellt, der Mensch sei das Maß aller Dinge, der seienden, dass/wie sie sind, und der nichtseienden, dass/wie sie nicht sind.
=> Eine Konsequenz daraus ist, dass alles Meinen subjektiv ist. Wenn z.B. der eine den Wind als kalt empfindet und der andere den Wind als warm empfindet, ist der Wind tatsächlich für den einen warm und für den anderen kalt, nicht zulässig wäre die Behauptung, dass der Wind in beiden Fällen dieselbe Temperatur hat, aber jeweils subjektiv unterschiedlich wahrgenommen wird, da ja Wahrnehmung und Wissen dasselbe sind.

=> Auf der metaphysischen Ebene würde dies bedeuten, dass Heraklit Recht hat und dass die Dinge niemals beständig sondern in ständiger Veränderung sind und deshalb niemals etwas Festes gefunden werden kann. In letzter Konsequenz wäre dann keinerlei Wissenschaft möglich. Daraus folgt umgekehrt, wenn es Wissenschaft und Wissen geben soll, kann nicht alles in jeder Hinsicht veränderlich sein, vielmehr muss es feste Anknüpfungspunkte bei etwas geben, dass sich nicht verändert, sondern immer gleich bleibt (bei Platon die Ideen).

Protagoras hat zunächst schon deshalb nicht Recht, weil seine Position in sich widersprüchlich ist: Wer behauptet, dass alles subjektiv ist, müsste dies auch für die eigene Behauptung akzeptieren, tatsächlich nimmt er aber für seine eigene These objektive Gültigkeit in Anspruch (pragmatischer Selbstwiderspruch). Daraus folgt im Umkehrschluss, dass zumindest das Nichtwiderspruchsprinzip von jedem, der überhaupt argumentiert, anerkannt werden kann. Folglich können keine Gegensätze in derselben Hinsicht von demselben Gegenstand ausgesagt werden. Daraus wiederum folgt, dass Heraklit nicht in jeder Hinsicht Recht haben kann, weil zumindest Gegensätze (Kontradiktionen) ausgeschlossen sind.

Protagoras hat aber auch in der Identifizierung von Wissen und Wahrnehmen nicht Recht, weil man mit Wahrnehmung allein gar nichts erkennen kann. Wenn man z.B. zwei Gegenstände vergleichen will, muss der Begriff der Gleichheit bereits anderweitig im Voraus bekannt sein, da er aus der Erfahrung nicht zu gewinnen ist. Bestimmte Begriffe also stammen nicht aus der Erfahrung und diese Begriffe verändern sich auch nicht, sondern bleiben sich immer gleich. Während also bei den Gegenständen nur bedingte und veränderliche Ähnlichkeit zu finden ist, bleibt der Bedeutungsgehalt der Idee der Gleichheit immer gleich. Das Gleiche selbst wird nie ungleich. (Daraus, dass hier auf der Seite der physischen Dinge eine unvollkommene Abbildung einer idealen Gleichheit stattfindet, schließt Platon dann auf das Verhältnis von Abbildung und Abgebildeten in den unterschiedlichen Stufen des Liniengleichnisses.)

Zu ergänzen wäre (was bei Platon aber zunächst nicht diskutiert wird), dass es nicht einmal möglich wäre, einen einzelnen Gegenstand als solchen zu identifizieren, wenn nicht zuvor ein Begriff vorliegt. Denn, um das Pferd auf der Wiese als solches identifizieren zu können, muss ich das Pferd bereits von der Wiese unterscheiden und feststellen können, dass das Pferd kein Teil der Wiese ist.

=> Protagoras und Heraklit haben nur bedingt Recht, denn nicht alle Teile, die für die Erkenntnis eine Rolle spielen, sind veränderlich, dies trifft lediglich auf die sinnliche Wahrnehmung und die sinnlich wahrnehmbaren Dinge zu. Der für die Erkenntnis entscheidende Teil, der sich auf das überhaupt Erkennbare richtet, ist unwandelbar und daher der Wissenschaft zugänglich. Um eine möglichst sichere Erkenntnis zu gewinnen, sollte man sich daher isoliert diesem Teil zuwenden. Dazu ist es für Platon erforderlich, dass das Erkennbare rein und an sich vorhanden ist, da es sonst immer mit der (der Täuschung unterliegenden) sinnlichen Wahrnehmung verbunden wäre. Für Platon folgt daraus, dass die Ideen nicht in den Dingen, sondern rein für sich existieren müssen.
2 Wissen ist richtige Meinung
Die Möglichkeit einer objektiven Erkenntnis ist demnach begründet im Vorhandensein von Begriffen, die unabhängig von Erfahrung existieren. Dass Menschen eine solche Erkenntnis haben können, hat zur Voraussetzung, dass sie Zugang zu diesen Ideen haben. Diese Möglichkeit wird bei Platon durch die (mystische) Vorstellung von der Seelenwanderung hergestellt:

Die Seelen haben die Ideen bereits vor ihrem Eintritt in das physische Leben geschaut. Auf diese Weise ist der Mensch im Besitz objektiv gültiger und richtiger Begriffe.

Dass es dennoch möglich ist, eine falsche Meinung zu haben, liegt darin begründet, dass die Ideen durch den Eintritt in ein physisches Leben undeutlich werden und vergessen werden. Obwohl deshalb die Ideen als Begriffe a priori dem dadurch erkannten Gegenstand logisch vorausgehen, kann es sein, dass die Begriffe historisch erst nachträglich wieder durch entsprechende Erfahrung aktualisiert werden müssen. (Lockes Einwand gegen die angeborenen Ideen zieht hier also nicht.)

Die beste Möglichkeit, wieder Ordnung und Klarheit in die Begriffe zu bringen, bietet die Dialektik, in der Begriffe (zunächst einigermaßen willkürlich) immer in zwei andere Begriffe unterteilt werden, so dass sich ein Begriffsbaum entwickelt. Indem mit allen anderen Begriffe ebenso verfahren wird, ergibt sich ein ganzes Netz von Begriffszusammenhängen (ähnlich wie eine mindmap), so dass sich das Verfahren auch dadurch überprüfen lässt, ob Erkenntnisse aus anderen Bereichen mit der aktuell vorgenommenen Begriffsunterteilung verknüpfen lassen.
3 Die Idee des Guten
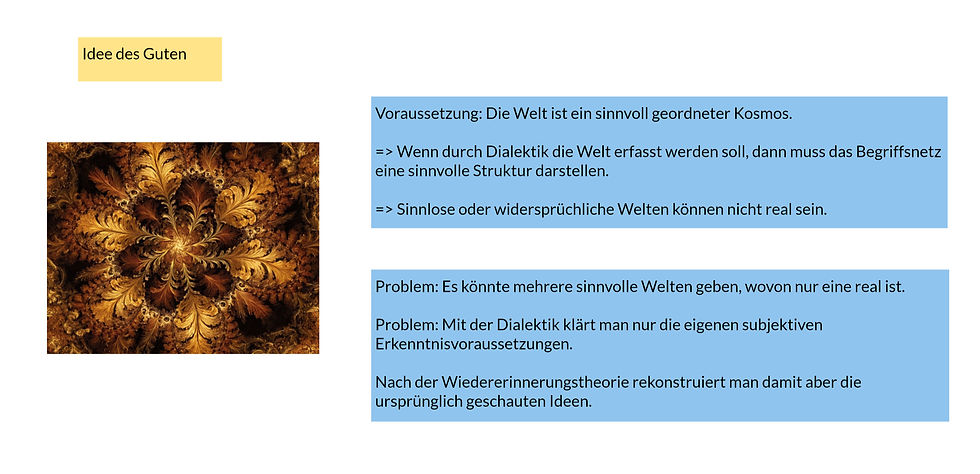
Für die Durchführung der dialektischen Methode spielt die Idee des Guten als oberstes Prinzip aller Ideen eine entscheidende Rolle: Alle Begriffsunterteilungen müssen so vorgenommen werden, dass sich insgesamt ein geordneter Kosmos von Begriffen ergibt, dem auf der metaphysischen Seite eine geordnetes Universum entspricht (für antike Griechen ist es unvorstellbar, dass die Welt ein Chaos ist). Alle Begriffsunterteilungen müssen also so vorgenommen werden, dass ihnen in der Wirklichkeit ein nach Zwecken sinnvoll gestaltetes Universum möglich ist.
4 Wissen ist richtige Meinung verbunden mit Erklärung
Lediglich zufällig das Richtige zu treffen, ist für Platon noch keine eigentliche Erkenntnis, diese ist vielmehr erst dann erfüllt, wenn man auch erklären (also aus den obersten Prinzipien gemäß der dialektischen Methode) deduzieren kann, warum das Erkannte auch notwendig so sein muss. Im Liniengleichnis werden deshalb die Fachwissenschaftler von den Philosophen unterschieden.

Die Fachwissenschaftler gewinnen aus der Beschäftigung mit sinnlichen Figuren abstrakte Gesetzmäßigkeiten auf dem Wege der Induktion. Diese Gesetzmäßigkeiten setzen sie aber einfach als wahr voraus (sie setzen Hypothesen), ohne sie weiter zu überprüfen bzw. aus den obersten Prinzipien abzuleiten.

Dies tun nur die Philosophen, die vom obersten Prinzip (der Idee des Guten bzw. dem Prinzip der Symmetrie) ansetzend die Gesetzmäßigkeiten deduktiv herleiten. Die Fachwissenschaftler leisten damit eine Interpretation der Natur in erster Ordnung, während die Philosophen eine Interpretation zweiter und höherer Ordnung liefern.
Platons Theorie der vorgeburtlichen Ideenschau und der anschließenden Ideenverwirrung leistet damit eine Entsprechung zu den angeborenen Ideen bei Descartes. Bei Descartes werden diese – auf welche Weise auch immer – den Menschen von Gott gegeben. Da aus dem Begriff Gottes geschlossen werden kann, dass diese die Menschen nicht betrügt, kann daraus geschlossen werden, dass die angeborenen Ideen objektiv richtig sind. Hier wie da besteht die Kunst des philosophischen Nachdenkens nicht darin, neue Erkenntnisse (durch synthetische Urteile) zu gewinnen, sondern sich (über analytische Urteile a priori) über das bereits vorhandene objektive Wissen Klarheit zu verschaffen. Bei Descartes hängt deshalb die objektive Gültigkeit von Urteilen davon ab, in welchem Grade die dabei verwendeten Aussagen deutlich und klar sind.
5 Metaphysik

Wenn die (wie auch immer) vorgeburtlich und a priori vorhandenen Begriffe auf Dinge in der Außenwelt angewandt werden sollen und in dieser Anwendung objektive Erkenntnisse erzeugen sollen muss es eine Entsprechung zwischen den Strukturen der Welt und den Strukturen des Denkens geben. Schon Parmenides hatte daher die Behauptung aufgestellt, Denken und Sein seien identisch.

Bei Descartes wird dies dadurch sichergestellt, dass derselbe Gott nach denselben Ideen die Welt geschaffen hat, die er auch den Menschen mitgeteilt hat. Auch Platon hat stellenweise (im Timäus) einen sogenannten Handwerker-Gott angenommen, der die Welt nach den ihr zugrundeliegenden Ideen geformt hat. Unter der Voraussetzung dieses Handwerker-Gottes ist dann die Analogie zu einem menschlichen Handwerker klar: Wie der Tischer einen Tisch baut nach einem im Vorhinein gemäß dem Verwendungszweck bestehenden Plan (der Idee des Tisches), so baut der Handwerker-Gott nach einer Idee von Pferden die Gattung Pferd, die die Grundmerkmale für alle Pferde abgibt.

Schwieriger werden die Verhältnisse, wenn auf diesen Gott verzichtet wird. Platon entwirft im Liniengleichnis und im Höhlengleichnis deshalb eine Theorie, nach der die (wenn auch eingeschränkte) Gleichheit von sinnlichen Dingen und Ideen durch ein Abbildungsverhältnis hergestellt wird. Wenn daher das betrachtende Subjekt die ideale Vorlage des sinnlichen Gegenstandes, von dem als einem Original der Gegenstand sich abbildet, kennt, so weiß er auch Bescheid über die wesentlichen Eigenschaften des Gegenstandes.

Um das Abbildungsverhältnis auf allen Ebenen der Erkenntnis – insbesondere auch da, von kein herstellender Mensch zwischengeschaltet ist – durchhalten zu können, müssten deshalb die Ideen selbst so etwas wie physische Gegenstände sein, die auf andere physische Gegenstände einwirken und sich in diesen abbilden zu können. Eben dies ist nach Platon aber unmöglich, weil die Ideen (in der Erkenntnistheorie) als etwas Denkbares (und gerade nicht Physisches) vorgestellt werden. Wenn aber die Ideen im Bewusstsein des Menschen Begriffe, in der Wirklichkeit aber Dinge sind, wie soll dann eine Übereinstimmung der Strukturen des Denkens und des Seins möglich sein?
6 Ideenlehre
Die Ideenlehre, die in ihrer einfachen Form noch auf der Vorstellung beruht, dass sich die Ideen in den Gegenständen abbilden, war von Platon zunächst an ethischen Fragestellungen entwickelt worden. Platon wollte das Verhältnis allgemeiner Begriffe zu besonderen Erscheinungsformen derselben klären. Dabei war vorausgesetzt, dass man z.B. die Gerechtigkeit einer einzelnen Handlung nur erkennen kann, wenn man weiß, was Gerechtigkeit allgemein ist, und ein Verhältnis der Deduktion von allgemeiner und besonderer Gerechtigkeit herstellen kann.
Der (Platonische) Sokrates war von Problemen der praktischen Philosophie ausgegangen. In seinen Gesprächen wurde sehr schnell klar, dass die meisten ethischen Probleme damit zusammenhängen, dass wir uns nicht klar darüber sind, was wir meinen, wenn wir Begriffe wie Tugend, Gerechtigkeit, Tüchtigkeit, Tapferkeit, aber auch solche wie gut, schön gebrauchen. Als ein zusätzliches Problem stellte sich bald heraus, dass die Dialogpartner von Sokrates auf die Frage „was ist gerecht? oder „was ist tapfer?“ regelmäßig mit Aufzählungen antworten, zum Beispiel „es ist gerecht, dem Staat zu dienen, es ist gerecht, seinen Freunden zu nützen usw.“.
Die ethischen Probleme lassen sich deshalb nach Sokrates nur dann lösen, wenn sich feststellen lässt, was den verschiedenen gerechten Handlungen eigentlich gemeinsam ist, das heißt, es muss festgestellt werden, worin das gerechte an sich oder die Gerechtigkeit überhaupt besteht, wodurch die vielen einzelnen gerechten Handlungen gerecht werden. Wenn man dieses gerechte überhaupt festgestellt hat, lässt sich durch Deduktion festlegen, welche einzelnen Handlungen gerecht genannt werden können, indem man überlegt, welcher Handlungen Anteil am allgemeinen Begriff der Gerechtigkeit haben.
Durch ein solches Verfahren, indem man feststellt, welche Handlungen unter die allgemeinen Begriffe von Gerechtigkeit, Tapferkeit, Tugend usw. fallen, kann man sogleich die Sophisten besiegen, deren Kunst darin besteht, die Menschen zu verwirren, indem sie Begriffe mit ständig wechselnden Bedeutungen oder unklaren Bedeutungen verwenden.
In den erkenntnistheoretischen Schriften der mittleren und späten Phase entwickelt Platon gemäß diesen in der Ethik gewonnenen Prinzipien eine Vorstellung von notwendigen apriorischen Begriffen, die einer sinnlichen Erkenntnis bereits vorausliegen müssen. Wenn z.B. zwei unterschiedliche Gegenstände (zwei Hölzer oder das Abbild einer Person und die Person selbst) miteinander verglichen werden sollen, muss der Begriff der Gleichheit und Ähnlichkeit bereits bekannt sein, denn nur so ist ein Vergleich überhaupt möglich. Ähnlich wie Hume kommt Platon also zu dem Ergebnis, dass allgemeine Begriffe (bei Hume Kausalität) nicht auf induktivem Wege durch Erfahrung sicher gewonnen werden können. Anders als Hume belässt es Platon aber nicht bei der dadurch erzeugen Unsicherheit, sondern behauptet, dass es ein deduktives Verhältnis von allgemeinen und besonderen Begriffen gibt, wodurch jederzeit eine Eindeutigkeit und Gesetzmäßigkeit hergestellt werden kann. Ähnlich wie Descartes (und Kant) geht Platon davon aus, dass solche allgemeinen Begriffe bereits vor aller Erfahrung a priori gegeben sind. Wie Descartes geht Platon davon aus, dass sie schon mit der Geburt gegeben sind, aber zunächst noch dunkel sind und wiedererinnert werden müssen. (Locke´s Argument, dass solche Begriffe, wenn sie angeboren sind, schon kleinen Kindern bekannt sein müssten, zieht hier also nicht, weil es durchaus mehr oder weniger klare Begriffe geben kann.)
Die größte Schwierigkeit der Ideenlehre liegt allerdings darin, dass es eine Übereinstimmung der Erkenntnisbedingungen (Ontologie) mit denen des Seins (Ontik) geben muss. Diese Übereinstimmung zwischen Denken und Sein hatte schon Parmenides als Voraussetzung dafür benannt, dass eine objektive Erkenntnis möglich ist. Um eine solche Übereinstimmung herzustellen, musste Platon also behaupten, dass die allgemeinen Begriffe nicht nur Grundlage für die subjektive Konstruktion der besonderen Begriffe beim menschlichen Erkennen sind, sondern auch objektiv im Sein die Gegenstände der Erkenntnis herstellen. Die Idee des Pferdes muss demnach ein reales Pferd, die Idee des Menschen einen realen Menschen erzeugen.
Hierfür war das ursprüngliche Schema der Abbildung nicht mehr ausreichend. Platon ersetzt dieses in der mittleren und späten Phase deshalb zunehmend durch das Schema der Teilhabe: Das einzelne Pferd ist ein Pferd, weil es an der Idee des Pferdes teilhat. Die Schwierigkeit besteht dann aber darin, wie man diese Teilhabe zu verstehen hat. Um die Eindeutigkeit der Allgemeinbegriffe und somit deren erkenntnistheoretischen Wert gegenüber den Einzeldingen zu sichern, hatte Platon definiert, dass die Ideen mit sich selbst identisch und von allen anderen Ideen verschieden sein und jeweils für sich selbst existieren müssten (Chorismos). Wenn aber die Ideen von den Dingen getrennt existieren, wie soll dann eine Teilhabe möglich sein? Wenn der Gegenstand nur einen Teil der Idee hat, realisiert er den Begriff auch nur teilweise. Außerdem ist der Begriff dann nicht mehr für sich selbst existent, da er ja zum Teil im Gegenstand ist (er ist dann auch nicht mehr eins, sondern in viele Teile geteilt).

Wenn aber Teilhabe doch so etwas wie Abbildung darstellen soll, wie erklären sich dann die vielen verschiedenen Varianten eines allgemeinen Begriffs? Es müsste dann einen zweiten Begriff geben, der die Verschiedenheit des einzelnen Menschen vom allgemeinen Menschen erzeugt (dritter Mensch). Dann müsste es aber einen weiteren Begriff geben, der das Verhältnis dieses dritten Menschen vom allgemeinen Menschen erklärt usw.. In der Folge ergäbe sich ein unendlicher Regress, indem immer neue Begriffe nötig werden, die die Abweichungen von anderen Begriffen erklärt. Schließlich müsste es für jeden einzelnen Menschen eine besondere Idee geben, die seine Besonderheit innerhalb des allgemeinen Menschseins erklärt. Aufgrund dieser Schwierigkeiten hatte schon Aristoteles erklärt, die Ideenlehre führe zu einer sinnlosen Verdopplung der Welt und zu einem unendlichen Regress, zudem müssten Ideen von Gegenstände angenommen werden (Schmutz, Kot usw.), für die sonst keine Ideen angenommen werden.

Diese Schwierigkeiten führen beim späten Platon (in den Dialogen Parmenides und Sophistes) zu einer grundsätzlichen Reflexion des Problems der Einheit. Anhand der Problematik des Eins soll überprüft werden, wie überhaupt sinnliche Existenz mit begrifflicher Eindeutigkeit verbunden werden kann. Im Ergebnis stellt sich heraus, dass das Eins nur eindeutig gedacht werden kann, wenn es nicht existiert, dann zwar eine gewisse Funktion für die Erkenntnis haben kann, aber keinerlei Bedeutung im Sein haben kann, weil es keinen Kontakt zu den Dingen geben kann. Wenn aber das Eins existiert, also sich in den Dingen der Welt abbildet, wird es zwangsläufig in viele unterteilt und verliert dadurch seine Einheitlichkeit. Folglich kann das Eins weder eine Existenz (ein Sein) haben, weil es dann seine begriffliche Einheit verliert, noch keine Existenz (Nichtsein) haben, weil es sonst keine Funktion für das Sein der Dinge haben kann.

In der fünften Untersuchung des Parmenides wird deshalb eine neue Kategorie des „plötzlich“ (exaiphnes) begründet, also ein Zustand jenseits der Differenzierung von Sein und Nichtsein, der in einem Punkt jenseits der Zeit einen Zustand erlaubt, in dem das Eins gleichzeitig sein und nichtsein, für sich sein und in anderem sein kann.
Mithilfe dieser neuen Kategorie kann dann auch eine Verbindung der Ideen in diesem „plötzlich“ zugestanden werden. In diesem Zustand hängen alle Ideen mit allen anderen Ideen zusammen und differenzieren sich erst anschließend in die einzelnen Begriffe und Gegenstände aus. Die Idee des Guten übernimmt jetzt die Funktion, eine Art homöostatisches Gleichgewicht und einen sinnvollen Kosmos zu garantieren innerhalb eines Zustandes, in dem prinzipiell alle Verknüpfungen von Ideen und damit unterschiedliche Welten möglich sind.
Auf diese Weise gelingt es Platon, auf der ontischen Seite des Seins dieselbe Grundlage zu schaffen wie im Bereich der Ontologie, wie sie in der dialektischen Methode zum Ausdruck kommt. Auf beiden Seiten gibt es jetzt Verbindungen aller Ideen mit allen anderen mit einer Vielzahl prinzipiell möglicher Verknüpfungswelten, die sich durch das Prinzip des Guten in eine begrenzte Zahl reduzierten lassen.
Video zum Beitrag:


Kommentare