Platons Epistemologie
- Stephan Sturm
- 29. Jan. 2025
- 18 Min. Lesezeit

In diesem Beitrag geht es um die Vorstellungen, die Platon in den Dialogen "Phaidon" und "Theaitetos" entwickelt. Die Ausführungen führen zu der Überlegung, warum Platons Ideenlehre aus seinen Vorstellungen zum Wissen folgen könnte und epistemologisch einen Sinn machen könnten. Er ergibt sich aus den Problemen, die sich ergeben, wenn man etwas näher betrachtet, wie es zu Wissen kommen kann und wie es falsche Vorstellungen geben kann.
Mit seinen Überlegungen setzt sich Platon mit dem sogenannten Homo-mensura-Satz von Protagoras auseinander. Protagoras hatte behauptet, es könne gar keine falschen Vorstellungen geben, bestenfalls bessere und schlechtere.
Naiver Realismus und naiver Sensualismus

Der naive Realismus sagt, dass unsere Vorstellungen die Außenwelt genau widerspiegeln. Das sieht man hier im Bild. Unser Kopf hat also ein Spiegelbild. Der Becher in der Außenwelt entspricht dem im Kopf. Damit das funktioniert, müssten wir einen Spiegel im Kopf haben. Aber das ist nicht so.
Wir haben keinen Spiegel im Kopf. Wir haben auch keinen Fotoapparat im Kopf. Was wir im Kopf haben, kann nicht einfach die Außenwelt spiegeln, weil wir dafür die Organe nicht haben. Es müsste in unserem Kopf wenigstens etwas entstehen, das dem ursprünglichen Gegenstand entspricht. Das ist aber nicht der Fall.

Wenn wir draußen einen Baum sehen, dann entsteht ja in unserem Kopf kein Baum. Das heißt, unsere Gedanken sind anders als die Realität.

Der naive Sensualismus geht noch ein Stück weiter, indem er quasi eine Mittelposition einnimmt.
Er denkt, dass es einen Baum gibt, der Partikel aussendet, die dann die Organe des Menschen beeinflussen und so die Außenwelt im Kopf des Menschen abbilden. Deswegen ist er naiv.

Wir denken, dass diese Teilchen Informationen über den Baum enthalten. So entsteht in unserem Kopf ein Bild des Baumes. Das Problem ist, dass die Partikel, die dieser Baum ausstößt, nicht kleine Bäume sind.
Die Frage ist also, wie der Baum die Partikel so aussendet, dass wir das ursprüngliche Bild im Kopf sehen, obwohl die Partikel nicht dazu passen.

Wenn wir davon ausgehen, dass Lichtwellen und Schallwellen die Partikel sind, dann sehen und hören wir den Baum. Das sind die Schallwelle und die Lichtwelle. Sie werden vom Menschen wahrgenommen. Der Mensch stellt sich dann einen Baum vor.
Das Problem ist, dass Schallwellen und Lichtwellen sich ja total unterscheiden. Die Frage ist also, wie das Gehirn aus Schall- und Lichtwellen ein Objekt zusammensetzt, das genauso aussieht wie die Außenwelt.
Wir haben jetzt ein zusätzliches Problem. Wir wissen nicht, ob das Ding, das wir mit Fragezeichen bezeichnet haben, wirklich so ist. Wir wissen nur, dass der Schallwellen und Lichtwellen aussendet, die irgendwie auf das Subjekt treffen.

Dann kommt das Problem, was im Kopf passiert. Das hat nichts mit dem ursprünglichen Gegenstand oder der Vorstellung zu tun. Die Schall- und Lichtwelle müssen also irgendwie übersetzt werden. Im Gehirn werden dann Verbindungen hergestellt und daraus wird ein Bild.
Wir haben also jetzt mehrere Übersetzungsprobleme, weil das, was wir uns vorstellen, nicht dem entspricht, was wir im Gehirn sehen.

Wir kommen der Sache näher, wenn wir uns an die Erinnerungen erinnern. In der Scholastik nennt man das "phantasia". Es sind also nicht irgendwelche Vorstellungen, sondern Erinnerungen. Die Vorstellungen bleiben erhalten, auch wenn der Gegenstand nicht mehr wahrnehmbar ist. Auch Platon hat dieses Problem gesehen. Das Folgende ist ein Auszug aus dem Phaidon.
Wissen im Phaidon

Wenn man sich an etwas erinnern will, dann geht das nur bei solchen Vorstellungen, die man vorher schon hatte, das ist der Sinn von Erinnerungen.
sondern auch noch etwas anderes vorstellt, das ganz anders ist, ob wir dann nichts sagen können, dass man sich nicht daran erinnert, was man gesehen oder gehört hat.
Wenn man sich an etwas erinnert, dann denkt man dabei auch an etwas anderes. Man kann sich also gleichzeitig an zwei Sachen erinnern. Oder man erinnert sich an etwas, das anders ist als das, was man gerade sieht. Man kann also verschiedene Dinge miteinander vergleichen.
Sokrates erläutert das jetzt an einem Beispiel.

Wenn man einen Menschen sieht, kann man sich an eine Leier erinnern. Zum Beispiel an den, der die Leier spielt. Aber das sind zwei verschiedene Dinge.
Jetzt kommen also die Assoziationen ins Spiel.

Wenn man eine Leier sieht, erinnert man sich an die Person, die sie üblicherweise spielt. Und wenn man nur den Simmias sieht, dann kann man sich auch an den Kebes erinnern, weil Simmias und Kebes normalerweise zusammen auftreten. Man kann sich also an unterschiedliche Dinge erinnern, die irgendwie zusammenhängen.

Als nächstes kann man sich nicht nur an verschiedene echte Dinge erinnern, sondern auch ein Bild vergleichen. Zum Beispiel ein Bild von einer Leier mit einer echten Leier oder mit jemandem, der diese Leier spielt.
Wenn man das Bild der Leier nicht als reales Objekt hat, sondern nur als Gemälde, kann man sich trotzdem an die Frau erinnern, die die Leier spielt. Und auch wenn man Simmias nur auf einem Gemälde sieht, kann man sich an Kebes erinnern, weil die beiden normalerweise zusammen auftreten.

Es ist klar, dass es sich bei dem Bild um Simmias handelt. Man kann das Bild mit dem echten Simmias vergleichen. Man kann Abbildungen mit den darauf abgebildeten Dingen vergleichen. Man kann aber auch dazwischen unterscheiden.
Das Foto zeigt die Frau, als sie noch jünger war. Man kann es mit dem jetzigen Erscheinung vergleichen. So sieht man, dass es sich um dieselbe Person handelt. Im zweiten Beispiel wird ein von einer jungen Dame mit enem jungen Mann verglichen. Und man stellt fest, dass beide verschieden sind. Dazu sind wir offenbar von Natur aus im Stande.

Wir erinnern uns an ähnliche und unähnliche Dinge. Diese Erinnerung ist notwendig, um Dinge wiederzuerkennen. Man muss diese Erinnerung haben, bevor man etwas wiedererkennt.
Der nächste Schritt besteht darin, mehr oder weniger viel Ähnlichkeit feststellen zu können.
Wenn sich jemand an etwas erinnert, muss er sich dann auch daran erinnern, ob es ähnlich ist oder nicht.“
Wir können uns daran erinnern, dass die Abbildung nicht der Gegenstand selber ist. Es gibt Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten.

Bei diesen Pferden ist es dasselbe Pferd. Aber das linke Bild sieht anders aus als das andere. Dieses Bild hier ist realistischer und hat mehr Details. Wir können also Ähnlichkeit und Unähnlichkeit unterscheiden und verschiedene Grade von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit definieren.
Platon entwickelt nun einen wichtigen Begriff: den der Gleichheit und Ungleichheit selbst.

Wir können nur vergleichen, wenn wir wissen, was es bedeutet, gleich oder ähnlich zu sein. Es geht also um eine Gleichheit, die an sich da ist, also eine mathematische Funktion der Identität. Diese ist anders als die Gleichheit zwischen Hölzern oder Steinen, denn die sind ja nie hundertprozentig gleich.
Und diesen Begriff müssen wir im Grunde genommen schon haben, bevor wir überhaupt in der Lage sind, irgendetwas miteinander zu vergleichen.

Wir können also jetzt drei Sachen unterscheiden. Rechts ist der Gegenstand. In der Mitte haben wir Vorstellungen. Wenn diese wahr sind, entspricht die Vorstellung dem Baum. Wir können uns gleichzeitig an etwas anderes erinnern, zum Beispiel an dieses Pferd oder an Simmias. Wir können feststellen, dass der Gegenstand kein Simmias ist und das kein Pferd, sondern ein Baum. Dafür brauchen wir Erinnerungen und bestimmte Verfahren, zum Beispiel Gleiches und Ungleiches.
Wir brauchen Erinnerungen, um den Baum zu vergleichen. Wir müssen wissen, was gleich und ungleich ist.
Diese Begriffe müssen wir kennen, um die Bilder mit der Außenwelt vergleichen zu können.

Das ist ein wichtiger Schritt. Die beiden Steine sind gleich, weil sie beide Steine sind. Sie sind unterschiedlich: Sie haben verschiedene Größen und wurden aus unterschiedlichen Perspektiven fotografiert. Auf der einen ist eine Schlange, auf der anderen nicht. Diese beiden Steine sind gleich, aber nicht identisch. Sie sind gleich, weil sie den gleichen Stein darstellen, aber ungleich, weil der eine Moos hat und der andere nicht. Obwohl sie gleich sind, sind sie auch verschieden.
Das ist das Problem. Wir brauchen Gleichheit, um festzustellen, dass Gegenstände in der Erfahrung nie wirklich gleich sind.

Die Gegenstände verändern sich ständig. Sie sind immer gleichzeitig gleich und ungleich. Deshalb ist es schwierig, eine Wissenschaft daraus zu machen. Unsere Erinnerungen verändern sich nur wenig. Wenn wir mehr Erfahrungen haben, können wir sie genauer verstehen. Aber im Vergleich zur Außenwelt verändern sie sich kaum. Auch die rein formalen Begriffe von Gleichheit, Ungleichheit und Entsprechung verändern sich nicht. Sie sind immer zu 100 % gleich. Gleichheit und Ungleichheit wechseln sich ab. Gleichheit ist nie ungleich und Ungleichheit nie gleich. Die Dinge der Außenwelt sind aber immer gleichzeitig gleich und ungleich.

Die gleichen Dinge und das Gleiche selbst können nicht dasselbe sein. Wir brauchen die Begriffe Gleichheit und Ungleichheit, um Ähnlichkeiten zwischen Dingen festzustellen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Gleichheit: die, die wir an den Steinen sehen können, und die, die wir als mathematische Begriffe sehen können.
Daraus folgt, dass es Begriffe gibt, die unabhängig von Erfahrungen sind. Diese Begriffe müssen getrennt existieren. Andernfalls wäre man ständig verwirrt, weil man die Ähnlichkeit zwischen den Steinen mit der Gleichheit als rein formaler Begriff verwechseln würde.
Es folgt eine wichtige Bewertung.
Wenn jemand etwas sieht, dass wie etwas anderes aussieht, aber nicht so ist, dann muss die Person, die das bemerkt, dieses andere schon kennen.
Wir brauchen ein Bild, das wir mit der Wahrnehmung vergleichen. Dann sehen wir, dass sie nicht gleich sind. Wenn wir formale Begriffe mit realen Dingen vergleichen, stellen wir fest, dass zwei Dinge in der Außenwelt nie exakt gleich sind.

Wir übertragen das formale auf das inhaltliche. Das Bild links zeigt also das Pferd, das wir sehen, und das Bild rechts zeigt das Pferd, das wir denken. Wir merken, dass das, was wir sehen, nicht genau dem entspricht, was wir denken. Das Bild rechts möchte wie das Pferd links sein, aber es bleibt dahinter zurück. Deshalb sieht es nicht ganz ähnlich aus.

Wir haben schon festgestellt, dass wir die Idee der Gleichheit brauchen, um zu vergleichen. Um die beiden Pferde vergleichen zu können, brauchen wir den Begriff der 100-prozentigen Identität. Aber dieser Begriff ist rein formal.
Platon hat das jetzt übertragen. Wir brauchen eine Idee vom Pferd, um ein echtes Pferd erkennen zu können. Das Bild hier zeigt also, wie wir uns Pferde vorstellen. Damit können wir unsere Vorstellungen mit dem Pferd hier vergleichen.

Wir brauchen nicht nur formale Begriffe von gleich und ungleich, sondern auch materiale Begriffe von Pferd, um ein Pferd erkennen zu können. Wir haben festgestellt, dass wir bestimmte Begriffe und Konzepte brauchen, um Dinge zu erkennen. Wir brauchen Begriffe wie "gleich" und "ungleich", um unsere Vorstellungen mit dem zu vergleichen, was wir in der Außenwelt wahrnehmen.
Wir brauchen den Begriff "abstrakte Pferde", um unsere Vorstellungen mit den Dingen in der Außenwelt vergleichen zu können. Dann können wir sagen, ob das, was wir in der Außenwelt sehen, ein Pferd ist oder nicht. Denn das, was wir in der Außenwelt sehen, sieht eher wie ein Baum aus als wie ein Pferd. Denn es entspricht besser der Funktion eines Baumes als die eines Pferdes.
Wir brauchen zwei Arten von Begriffen: formale und materiale. Die formalen Begriffe dienen dem Vergleich. Die materiellen Begriffe vergleichen wir mit unseren Wahrnehmungen und Erinnerungsbildern.
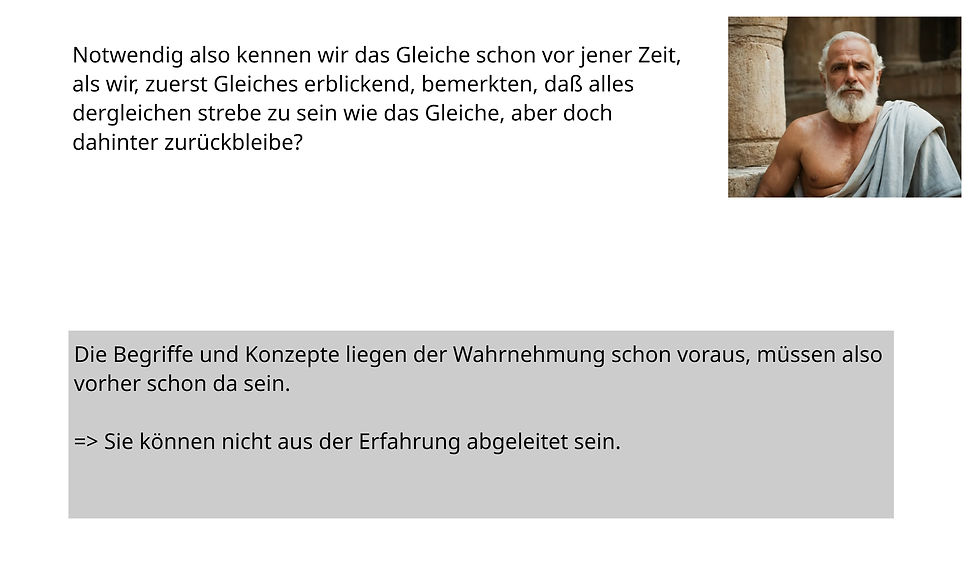
Wir können also feststellen, dass bestimmte Begriffe und Konzepte der Wahrnehmung vorausliegen. Diese können nicht aus der Erfahrung abgeleitet sein, da man sie braucht, um Erfahrungen zu machen. Das Problem ist natürlich die Frage: Müssen diese Begriffe vor jeder Wahrnehmung überhaupt (also angeboren o.ä.) da sein oder nur vor einer bestimmten Wahrnehmung (können also von einer Wahrnehmung davor abgeleitet sein)?
Platon ist wie die meisten Rationalisten der Meinung, dass wir bestimmte Begriffe schon als Baby haben. Denn sonst könnten wir keine Erfahrungen machen. Empiristen sind da anderer Meinung. Sie denken, dass wir diese Begriffe nur haben, nachdem wir etwas erlebt haben. Aber diese Begriffe können auch aus der Wahrnehmung kommen.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir bestimmte Begriffe schon vorher haben und diese Begriffe nie der Veränderung und der Gleichheit und Ungleichheit unterliegen, stellt sich die Frage, wie es zu einem Irrtum kommen kann.
Wissen im Theaitetos
Wachstafelgleichnis

Und das versucht also Platon im Theatetos mit dem Wachstafelgleichnis zu erklären. Für Rationalisten wie Platon ist klar, in dieser Wachstafel, die wir in unserem Kopf haben, sind immer schon Bilder drin, die wir dann mit dem, was wir in der Außenwelt sehen, vergleichen können. Empiristen dagegen gehen davon aus, dass ursprünglich auf dieser Tafel gar nichts stand, das ist die berühmte Tabula rasa bei Locke: Ursprünglich sind hier überhaupt keine Eindrücke drin, die kommen überhaupt erst aus der Erfahrung.
Bei Platon kommen sie aber nicht aus der Erfahrung, weil sie schon die Voraussetzungen dafür sind, dass wir überhaupt Erfahrungen machen können.

Die Vorstellung ist also: Wir haben so eine Wachstafel im Hirn, und da bilden sich bestimmte Abdrücke aus, in diesem Falle von dem Baum, von dem Pferd und von Menschen.
Wir können also Bäume, Pferde und Menschen erkennen und vergleichen, weil wir das Bild im Kopf haben. Das heißt, in unserem Kopf sind tatsächlich Bilder. Die sind also die Voraussetzungen dafür, dass wir überhaupt etwas wahrnehmen können, weil wir dafür vergleichen können müssen. Die unterschiedlichen Größen der Wachstafeln sollen zeigen, dass Menschen unterschiedlich gut merken können. Feuchte Stellen im Gedächtnis helfen dem Menschen, sich schneller zu erinnern. Bei einer härteren Wachstafel dauert es länger. Das erklärt, warum manche Menschen schlauer sind als andere.

Er geht davon aus, dass das so ist: Wir haben diese Wachstafel im Hirn. Das ist ein Geschenk der Mnemosyne. Das ist Erinnerung. Diese Wachstafel ermöglicht es uns, uns an Dinge zu erinnern. Wir können uns an bereits gesehene Dinge wie dieses Pferd erinnern. Oder an Dinge, an die wir nur gedacht haben, wie diese Idee des Pferdes.
Und dann können wir, weil wir diesen Abdruck haben, das gedachte Pferd mit dem gesehenen Pferd vergleichen und feststellen: Das entspricht diesem Eindruck von dem Pferd. Obwohl die dargestellten Pferde nicht gleich sind, können wir die Gedanken und unsere visuellen Eindrücke diesem Abdruck von dem Pferd zuordnen.

Es geht nun darum, ob man etwas falsch vorstellen kann. Und wenn ja, wie das geht.
Man kann zwei Abdrücke in der Seele nicht verwechseln. Man kann diesen Baum nicht für ein Pferd und dieses Pferd nicht für einen Baum halten. Man kann das Pferd nicht auf den Baum beziehen, jedenfalls wenn man ihn nicht sieht. Das Pferd ist nur in der Vorstellung da. Man kann nicht glauben, dass das Pferd ein Baum ist, weil das nur in der Seele oder im Gehirn passiert.
Zunächst gibt es da keine Verwechslung.

Man kann also, wenn man ein richtiges Zeichen von diesem Baum und ein richtiges Zeichen von diesem Pferd im Kopf hat, das wahrgenommene Pferd nicht mit dem Baum verwechseln. Man kann also die Wahrnehmung nicht dem falschen Gedanken oder dem falschen Erinnerungsbild zuordnen. Das ist unmöglich.
Die Sache wird also komplizierter. Wir müssen jetzt drei Sachen annehmen, damit es zu einer falschen Vorstellung kommen kann.

Die ersten Fälle waren unmöglich. Jetzt muss einer konstruiert werden, in dem ein Irrtum möglich ist.
In diesem Falle hat er also zwei materiale Ideen im Kopf, das Pferd und den Baum. Hier besteht die Möglichkeit einer Verwechslung, und zwar dann, wenn man gleichzeitig eine Wahrnehmung hat. An sich kann man die beiden nicht verwechseln. Aber wenn eine Wahrnehmung im Spiel ist (diese Wahrnehmung hat ja sowohl Ähnlichkeiten mit dem Pferd, also auch jetzt hier so im Hintergrund mit dem Baum), dann kann das dazu führen, dass man diese beiden Vorstellungen verwechselt und dann das Pferd in seiner Erinnerung dem Baum zuordnet. Bei so einem Dreierverhältnis ist also im Prinzip eine Täuschung möglich.

Auch hier ist es klar. Man kennt den Apfel nicht und verwechselt ihn mit einem Pferd, weil man eine klare Vorstellung von einem Pferd hat, aber keine vom Apfel.
Man hat das Bild nicht im Kopf. Man hat in der Wachstafel nur Baum, Pferd und Menschen. Man kann den Apfel nur einem von diesen drei Bildern zuordnen, weil man von dem Apfel eben keine Vorstellung hat. Dann stellt man sich natürlich den Apfel falsch vor.

Hier verwechselt man im Kopf nicht das Bild vom Pferd mit dem Bild vom Baum, sondern man verwechselt die Wahrnehmung. Man kann den Baum nicht klar erkennen und hält ihn für ein Pferd. Man weiß, was ein Pferd ist und was ein Baum ist, aber in der Wahrnehmung verwechselt man beides.

Hier kann man sie nicht verwechseln. Das eine ist Theodoros und das andere ist Theaitetos. Man kann sie nicht verwechseln, weil man weiß, wer wer ist. Das funktioniert, weil man nichts wahrnimmt. Nur in Kombination mit der Wahrnehmung können sich hier Fehler einschleichen.

Wenn ich Theodoros kenne, aber Theaitetos nicht, kann ich den nicht mit dem anderen verwechseln. Es geht um Fälle ohne Wahrnehmung. Also auch hier ist eine Verwechslung zwischen reinen Gedanken unmöglich.

Auch das ist klar. Wenn ich zwei Personen nicht kenne, kann ich sie nicht verwechseln. Ich habe keine Informationen über sie.

Hier kann ich mich also täuschen. Ich habe klare Gedanken und kann die Gedanken von Theodoros von den Gedanken an Theaitetos unterscheiden. Aber ich habe unklare Vorstellungen. Wenn ich ein sehr undeutliches Bild von Theaitetos habe, kann ich das auf ein klares Bild von Theodoros beziehen und mich dadurch irren. Oder ich habe eine unklare Wahrnehmung von Theodoros und ordne sie fälschlicherweise einer klaren Vorstellung von Theaitetos zu.
Das können wir jetzt wieder auf unsere ursprüngliche Vorstellung zurückbeziehen. Die Vorstellungen sind unklar, weil sie aus Schall- und Lichtwellen bestehen. Dabei findet eine Art Übersetzung statt, die manchmal Fehler macht. Das Gehirn stellt dann Verbindungen her. Auch hier können die Übertragung der Schall-, Wellen- und Lichtwellen auf die Neuronen falsch sein. Und die Übersetzung dieser Verbindungen im Gehirn kann falsch sein. Diese Fehler entstehen, weil das Gehirn die Informationen übersetzen muss.

Wir nehmen nicht unbedingt etwas aus der Ferne wahr und ordnen deshalb falschen Bildern im Kopf zu. Die Unklarheit liegt schon im Wahrnehmungsprozess begründet. Wir haben ein Verhältnis von zwei Größen, die wir nicht kennen. Wir müssen die Schall- und Lichtwellen irgendwie in Bilder übersetzen. Diese Bilder können aber selber schon unklar sein. Selbst wenn wir eine klare Vorstellung von Theodoros hätten, könnte die Übersetzung von Schall- und Lichtwellen in das Bild „Theodoros“ scheitern, weil wir die Übersetzung nicht hinbekommen. Selbst wenn wir genau wüssten, wer Theodoros ist, könnte es trotzdem nicht funktionieren, weil wir die Übersetzung von Schall- und Lichtwellen nicht hinbekommen.
Die Vorstellung von Theodoros oder Theaitetos könnte so unklar sein, dass wir selbst wenn wir sie klar sehen, sie nicht verstehen, weil unsere Vorstellungen im Hirn undeutlich sind.
Die Denkvorgänge, die für eine Wahrnehmung wichtig sind, sind keine passiven Vorgänge. Sie erfordern eine aktive Tätigkeit. Wir sehen das hier am Kind, das etwas Neues entdeckt. Es untersucht einen Schatten oder ein Spiegelbild. Das Kind muss herausfinden, warum das so ist.
Wir müssen jetzt auch daran denken, dass es zwischen den passiven Vorgängen auch aktive Leistungen gibt. Diese können neue Fehler verursachen.

Taubenschlag-Gleichnis

Die Vorstellung ist also: Es liegt nicht daran, dass die Wahrnehmungen so schlecht sind. Es liegt auch an sich nicht daran, dass die Gedanken so schlecht sind, sondern es liegt daran, dass das Vergleichen von Wahrnehmungen und Gedanken nicht funktioniert.
Jetzt sagt Sokrates, was jemand vielleicht dagegen sagen könnte. Dieser Fremde sagt, du meinst, du hast herausgefunden, warum Vorstellungen falsch sein können.
Der entscheidende Einwand, den jemand machen könnte, ist: Die Voraussetzung war, haben wir ja gesehen, in Gedanken als solchen kann man sich nicht erinnern, nur in der Kombination von Gedanken und Wahrnehmungen kann man sich irren. Die Frage ist, ob man sich in seinen Gedanken auch irren kann. Das heißt, dass man schon beim Denken selbst ein Problem hat.
Platon versucht das mit dem berühmten Taubenschlaggleichnis zu erklären. Er will Erkenntnisse mit Tauben vergleichen.

Wir denken hier nur, ohne etwas zu sehen oder zu hören. Bisher haben wir gesagt, dass der Fehler nur entsteht, wenn man etwas wahrnimmt und dann darüber nachdenkt. Jetzt untersuchen wir, wie das Denken selbst funktioniert.
Die Frage ist, ob man zwei Zahlen verwechseln kann, wenn man nur mathematisch denkt. Man muss wissen, dass für Platon die Elf und die Zwölf zu kennen, bedeutet, zu wissen, welche Zahlen man addieren muss, um auf Elf und Zwölf zu kommen, oder welche Zahlen man multiplizieren muss und durch welche Zahlen man diese Zahlen teilen kann. Man muss also nicht nur wissen, dass die Elf mit zwei Einsen schreibt, sondern auch, aus welchen Zahlen man die zusammensetzen kann.

Es geht hier nicht um Wahrnehmung. Wir denken uns die Zahlen fünf und sieben. Zusammen sind sie zwölf, nicht elf. Natürlich könnte es Schüler in der ersten Klasse geben, die meinen, dass fünf plus sieben nicht zwölf, sondern elf ist. Man kann sich also irren, wenn man nicht addieren kann.
Und dieses Problem wird jetzt zurückbezogen auf das ursprüngliche Gleichnis von der Wachstafel.

Das würde also im Wachstafelgleichnis bedeuten, dass er zwei Eindrücke in der Wachstafel verwechselt: die zwei Einsen mit der eins und zwei verwechselt und dadurch die Verwechslung zustande kommt, die darin besteht, dass er eben falsch addiert hat. Das wäre also einfach die Bezugnahme von zwei Zahlen auf zwei Eindrücke in der Wachstafel, was eigentlich nicht gehen kann.
Das Problem ist: Wir hatten diesen Fall ausgeschlossen. Wir hatten gesagt, dass man die Vorstellungen von Theodoros und Theaitetos nicht verwechseln kann. Daraus folgt, dass man auch elf und zwölf nicht verwechseln kann.

Wenn man Theodoros und Theaitetos verwechselt, könnte man gleichzeitig wissen und nicht wissen. Das ist unlogisch.
Das Problem lässt sich nicht auf der bisherigen Ebene lösen. Wir brauchen also einen neuen Ansatz, um herauszufinden, warum man sich im reinen Denken auch irren kann. Wir müssen zeigen, dass falsche Vorstellungen nicht dasselbe sind wie Verwechslungen von Gedanken und Wahrnehmungen. Denn sonst würden wir uns nicht in unseren Gedanken selbst irren.
Entweder gibt es keine falsche Vorstellung oder man kann etwas nicht wissen und es trotzdem denken.
Es ist komisch, dass man etwas wissen kann, ohne es zu denken. Wir brauchen also ein neues Beispiel, um dieses Problem lösen zu können. Dafür stellen wir die Frage, was Wissen eigentlich ist, noch einmal genauer. Wir beschäftigen uns noch einmal mit der Frage, was Wissen eigentlich ist.

"Es" heißt hier das Wissen. Ursprünglich haben wir definiert: "Wissen ist das Haben von Erkenntnis." Das müssen wir jetzt differenzieren.
Es geht um den Unterschied zwischen dem Haben und dem Besitz von Erkenntnissen. Eine Erkenntnis besitzen ist nicht dasselbe wie eine Erkenntnis haben. Wir werden gleich sehen, wo der Unterschied liegt.
Genau an dieser Stelle kommt jetzt eben das Taubenschlaggleichnis ein, in dem also Erkenntnisse mit Tauben verglichen werden.

Zuerst jagt man Vögel oder Tauben und sperrt sie ein. Dann hat man die Tauben.

Er hat also jetzt diese Erkenntnisse in seinem Taubenschlag. Aber er hat sie nicht in der Hand. Er kann aber jederzeit eine Taube aus dem Taubenschlag holen. Er hat wilde Tauben gejagt und hat sie jetzt in seinem Taubenschlag. Aber er muss sie rausnehmen, um sie zu nutzen.

Wir dachten, jemand hat eine Wachstafel im Kopf. Jetzt nehmen wir also an, dass er Vögel in seinem Kopf hat. Die Vögel sind Erkenntnisse. Er kann sie aus seinem Kopf wieder herausholen.
Er hat also in seiner Kindheit etwas gelernt. Am Anfang war das Behältnis leer. Jetzt hat er Erkenntnisse. Er hat was gelernt und es für sich behalten. Die Erkenntnisse sind also Vögel. Er hat jetzt diese Erkenntnisse. Er muss lernen, sie zu nutzen. Das kommt als nächstes.
Das wird jetzt zur doppelten Jagd ausgeweitet.

Man muss also auch das Wissen, das man schon hat, noch aktiv wieder jagen, also hervorholen, um es verwenden zu können. Darin besteht also eine zweite Fehlerquelle, dass man das, was man eigentlich weiß, wieder vergisst oder nicht wiederfinden kann oder ähnliches.
Jetzt wird das Ganze also auf die Mathematik angewendet. Also eine Kunst, die man im Prinzip in reinem Denken vollziehen kann.

Gerade und ungerade Zahlen sind ein Beispiel. In der Arithmetik geht es um mehr als nur gerade und ungerade Zahlen.
Wenn jemand rechnen kann, dann hat er die Zahlen unter Kontrolle. Er weiß es im übertragenen Sinne. Wenn er Ahnung von Arithmetik hat, kann er diese Kenntnis auch auf andere übertragen. Er kann anderen also erklären, wie man Zahlen addiert.

Vom Wachstafelgleichnis ausgesehen, hat er ja so jetzt Abdrücke von allen Zahlen in seinem Gehirn. Im Taubenschlagbeispiel hat er jetzt also die Tauben in seinem Taubenschlag. Jetzt muss er damit irgendetwas machen.
Wenn man eine Rechnung ausführen will, dann muss man quasi die richtige Zahl rausfinden. Das Kind muss sich also anstrengen, um mathematische Erkenntnisse, die es eigentlich schon gefunden hat, in der Hausaufgabe jetzt zu reproduzieren und wieder hervorzuholen.

Das sieht nach einem Widerspruch aus. Wie kann man nach etwas suchen, das man weiß? Die Lösung ist einfach. Man hat vergessen, wie man auf die Idee gekommen ist. Oder man hat die Kenntnisse vergessen. Das arme Kind hat zwar Mathe gelernt, aber es weiß trotzdem nicht, wie es auf die richtige Lösung kommt.
Daraufhin wird jetzt also der Mythos der doppelten Jagd entwickelt.

Manchmal erinnert man sich an Dinge, die man eigentlich nicht wahrgenommen hat. Die erste Jagd besteht also darin, Erkenntnisse zu sammeln.
Das ist ein aktiver Vorgang, bei dem man etwas lernt. Die zweite Jagd besteht darin, diese Erkenntnisse wiederzufinden und zu nutzen. Man weiß zwar schon Bescheid, hat es aber gerade nicht zur Hand.
Wir müssen uns an dieses Kind erinnern und daran, dass es etwas suchen muss. Im nächsten Teil sehen wir, dass die Suche etwas für Menschen sehr Typisches ist. Sie entdecken den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, wenn sie feststellen, dass sie selber eine Wirkung vollziehen können, mit dem was sie machen. Sonst können sie nicht feststellen, dass sie ein Mensch sind und keine Erfahrung machen, bei der sie selbst etwas bewirken.
Wir können also sagen, dass das, wie Menschen sich selbst sehen, mit dem zu tun hat, was sie wissen. Wenn man einem Kind den Stift wegnimmt, merkt es, dass es nichts bewirken kann. Und so kann es auch keine Erkenntnisse haben. Deshalb hängt die Erkenntnistheorie mit der Anthropologie zusammen. Wir müssen uns als selbstwirksam erleben, um die Kausalität zu begreifen.
Hier ist ein Auszug aus einem Vortrag von Markus Gabriel zur Ontologie. Gabriel sagt im Grunde das Gleiche wie Platon: Wir brauchen Begriffe, die wir schon haben, bevor wir Erfahrungen machen. Gabriel und Platon sind sich einig: Wir brauchen Begriffe, die wir schon kennen, bevor wir Erfahrungen machen. Er sagt, wir brauchen Sinnfelder, um zu definieren, was wir erleben können.
Wir brauchen also Begriffe, bevor wir Erfahrungen machen. Die haben wir nicht aus der Erfahrung selbst. Wenn wir aber davon ausgehen, dass diese Begriffe nur in unserem Kopf existieren und dass es in der Außenwelt nichts gibt, das dem entspricht, dann ist das Konstruktivismus. Konstruktivismus ist eine Philosophie, nach der alles, was wir erleben, durch die Begriffe erzeugt wird, die wir haben. In Wirklichkeit existiert nichts von alledem. Das sagt man in der Philosophie, wenn man sich damit beschäftigt, wie Sprache alles beeinflusst.
Es ist klar, dass man Kunstprodukte und natürliche Produkte unterscheiden kann. Den Begriff für Tomatensauce mussten wir entwickeln, nachdem wir entdeckt hatten, was man aus Tomatensoße machen kann. Wir haben erst ein Konzept entwickelt und dann einen Namen dafür gesucht. Der Konstruktivismus sagt das Gleiche auch von Bäumen. Bevor es die Wörter für Bäume gab, gab es keine Bäume, weil man sie nicht kannte.
Wir nähern uns also dem Platon'schen Universalienrealismus. Wenn wir alles, was wir erkennen können, nur durch Begriffe erschaffen haben, die für uns subjektiv sind, und es dem gegenüber tatsächlich etwas in der Außenwelt gibt, dann müssen diese Begriffe schon gegeben sein, bevor wir Erfahrungen machen.
Wir sind also in der Ideenlehre angekommen. Diese Sinnfelder zeigen, dass bestimmte Aussagen in diesem Feld sinnvoll sind. Das Sinnfeld der Quadrate zeigt, dass es drei Quadrate gibt. Aus einer anderen Perspektive sieht man das anders. In einer anderen Perspektive sind andere Aussagen wahr.
Jetzt könnte man im Prinzip hingehen und sämtliche Sinnfelder konstruieren, die dafür sorgen, dass wir durch bestimmte Umstände in der Wirklichkeit getriggert werden und die dann erkennen können.
Damit wir diese drei Quadrate erkennen können, müssen wir uns in diesem Sinnfeld befinden. Dieses Sinnfeld existierte auch schon immer unabhängig von uns. Wir müssen nicht in eine bestimmte Weise gucken, um die drei Quadrate zu sehen. Die sind schon da. Man könnte die Quadrate zählen.
Platon will mit Dialektik zeigen, welche Sinnfelder einen Sinn ergeben. Dafür ist die Idee des Guten entscheidend. Ein Sinnfeld ist ein Sinnfeld, wenn es einen Sinn ergibt. Also wenn Aussagen in dem Sinnfeld zusammenpassen. Sinnfelder, die aus Aussagen bestehen, die sich widersprechen, sind sinnlos. Aber wir brauchen sie, um etwas zu erkennen. Diese Sinnfelder zeigen uns nicht die Gegenstände selbst, sondern sie zeigen uns eine Perspektive. Von dieser Perspektive aus können wir die Gegenstände erkennen.
Video zum Beitrag:


Kommentare